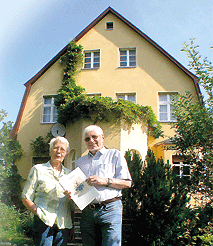|
|
Alles Pustekuchen, war wohl nichts gewesen! Das geflügelte Wort als Ausdruck von Schadensfreude kennt wohl jeder. Doch wer würde denken, dass die Wurzeln dieses Ausdrucks nach Falkensee reichen?
Und zwar exakt zu Elisabeth Dahl. Sie entstammt einer alten Finkenkruger Familie und wohnt nach einem „Abstecher“ nach Westdeutschland wieder im elterlichen Haus in Finkenkrug.
Ihr Urur-Opa war Dr. Friedrich Wilhelm Pustkuchen-Glanzow. Der war Pastor in Lieme und lebte von 1793 bis 1834. Obwohl er also nur 41 Jahre alt wurde, sorgte er zu seiner Zeit für mächtigen Wirbel. Denn er legte sich ausgerechnet mit dem damals bereits hochgeschätzten Geheimrat und Dichter-Fürsten Johann Wolfgang von Goethe an.
„Er sah in Goethe einen Anti-Christen und wollte die Welt darauf aufmerksam machen“, hat Hans Rhinow herausgefunden.
Er ist der Ehemann von Elisabeth Dahl und beschäftigt sich mit Familienforschung. Demnach schrieb Pustkuchen die Fortsetzung des frühen Goethe-Bestsellers „Wilhelm Meisters Lehrjahre“. Das Goethe-Buch war 1796 erschienen. Goethe selbst wollte eigentlich den Nachfolgeband schreiben, kam aber 25 Jahre wohl nicht dazu. Pustkuchen nahm ihm ungebeten die Arbeit ab und veröffentlichte im Mai 1821 als anonymes Werk „Wilhelm Meisters Wanderjahre“.
Darin nahm er den Dichterfürsten gehörig aufs Korn. Goethe wurde durch seine eigene Romanfigur Wilhelm Meister der „Fremdländelei, der Abneigung vor dem Glauben, moralisierender Schwäche, hektischer Sentimentalität“ und sogar der „Lüsternheit“ bezichtigt. Außerdem heißt es dort, „das alles macht Goethe zum Symbol des vorigen Jahrhunderts“.
Das Anti-Goethe Buch war so erfolgreich, dass den ersten beiden Bänden vier weitere folgten und schließlich auch noch „Wilhelm Meisters Tagebuch“ dazukam. Als Goethe dann im Herbst 1821 seinen „echten“ Wilhelm Meister vorstellte, raunte es ihm vielfach entgegen: „Pustekuchen, zu spät dran!“
Und im direkten Vergleich fanden sogar etliche Kritiker das Pustkuchen-Werk viel besser, als den Wilhelm Meister aus der Feder des Geheimrats. „Aus dieser Zeit erhielt sich der Ausdruck ’Pustekuchen’ als geflügeltes Wort“, so Rhinow. Goethe übrigens muss sich über den Widersacher enorm geärgert haben. Davon zeugen etliche Schmähgedichte.
Hobby-Ahnenforscher Hans Rhinow fand aber noch mehr über die Geschichte seiner Finkenkruger Ehefrau, mit der er mittlerweile 49 Jahre verheiratet ist, heraus: So sorgte Alheyd Pustekoke, wenn auch unfreiwillig, 1442 dafür, dass ihr Heimatort Blomberg bei Detmold in Ostwestfalen-Lippe zu einem frühen Touristenmagnet wurde. Sie klaute eine Hostienschale und warf in ihrer Not, um nicht entdeckt zu werden, die Hostien in einen Brunnen. Das bewahrte sie nicht vor der Strafe durch Verbrennen, doch der Brunnen soll danach Heilwasser beinhaltet haben. Das war der Anlass für eine Klostergründung und einen erheblichen Besucheransturm. Noch heute vermarktet die Stadt diese Ahnin und hat ihr sogar eine Brunnenfigur gewidmet.
ZUR PERSON
Hans Rhinow ist exemplarisch für Falkensee. „Wer einmal hier war, kommt wieder“, sagt er. Das trifft auf ihn besonders zu. Er kam mit seiner Familie als Kriegsflüchtling aus der Ostmark nach Falkensee. Sie wurden damals im Ort so herzlich aufgenommen, dass Rhinow von der Gastfamilie als „meine zweite Mutter“ spricht. In der Schule funkte es zwischen dem 14-jährigen Hans und der 15-jährigen Elisabeth Dahl. Leider zog ihre Familie bald nach München. Hans Rhinow dagegen wurde Lehrer in Nauen und war erfolgreicher Leichtathlet. Doch die Sehnsucht bohrte, und die junge DDR wollte von ihren Pädagogen die damals stalinistische Weltsicht verbreitet haben. Also zwei wichtige Gründe, dass Hans seiner Elisabeth hinterherzog. In München hieß es nochmals Prüfungen abzulegen. Schließlich landete der Preuße in Bayern in der „Landesschule für Blinde“ wo er sich bis zum stellvertretenden Schulleiter hocharbeiten konnte. „Mehr konnte man als Protestant in Bayern nicht werden“, musste Rhinow feststellen und nahm deshalb den Ruf an die Spitze der Nikolauspflege in Stuttgart an, der er bis zur Pensionierung vorstand. Dort war er für 350 Mitarbeiter verantwortlich. Zudem war er erst 14 Jahre lang bayrischer Landesvorsitzender und dann zehn Jahre Bundesvorsitzender des „Berufsverbandes der Blinden- und Sehbehindertenpädagogen“.
Nach der Pensionierung 1996 zog es Elisabeth und Hans Rhinow in die alte Heimat Falkensee. Sie renovierten das Elternhaus der Dahls in Finkenkrug. Die vier Kinder als eingefleischte Bayern hielten die Idee für weniger gut. Matthias, Martin und Markus wirken in München als Gymnasiallehrer, Computertechniker und Pfarrer. Sohn Malte ist Pfarrer im südkoreanischen Seoul.
Nach der Pensionierung wollte der erfolgreiche Pädagoge in Finkenkrug ein neues Leben anfangen. Nun ist er als Geschichtsforscher tätig. Er ging den Spuren der Rhinows, seiner Familie, nach und musste erkennten, dass die Ahnen seiner Ehefrau viel spektakulärer sind. Nun arbeitet Hans Rhinow an Falkensees Historie – man darf gespannt sein, was er da herausfindet.
|
|
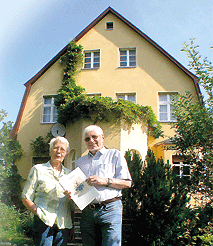 |
|